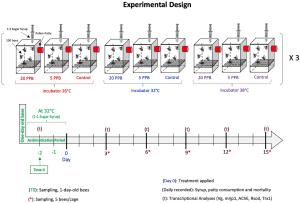Komplexe Kontamination mit Pestiziden

Pestizide werden auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht, finden sich durch Abdrift aber auch in umgebenden unbewirtschafteten Blühflächen und wurden sogar in Naturschutzgebieten nachgewiesen. Bestäuber wie Honig- und Wildbienen leiden in unterschiedlichem Maße unter den Belastungen durch Pestizide in der Umwelt.