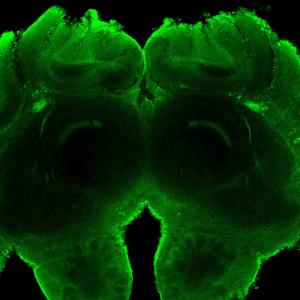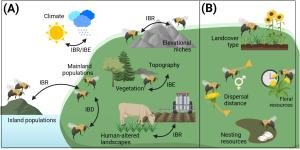Eine der wohl ältesten Beziehungen zwischen Mensch und Tier ist die der Honigbiene. Noch bis zum 26. Februar 2026 geht die Schau „Honiggelb - Die Biene in der Natur und Kulturgeschichte“ auf die Reise durch fast 14.000 Jahre Menschheitsgeschichte: Von den ältesten archäologischen Nachweisen über weltweite ethnologische Zeugnisse bis zu biologischen Fakten. Das besondere Plus: Parallel zeigt das Museum die Ausstellung „Honiggelb - Die Biene in der Kunst. Von der Renaissance bis zur Gegenwart“, allerdings nur noch bis zum 22. Juni 2025. Bis dahin sind zahlreiche Leihgaben europäischer Museen zu sehen, darunter Arbeiten von Lucas Cranach d. Ä., Nicolas Poussin, Hans Thoma und Émile Gallé bis hin zu Joseph Beuys und Rebecca Horn.