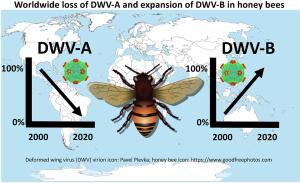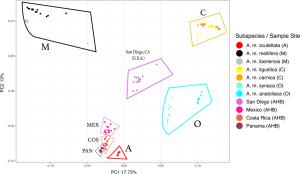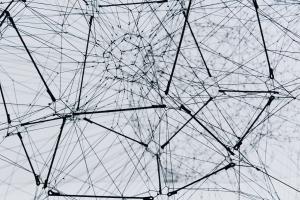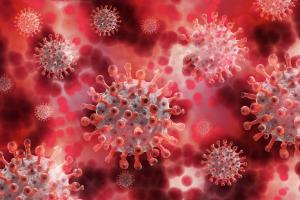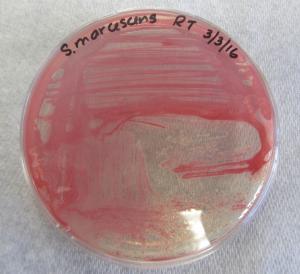Bienen-Algorithmus hilft bei Optimierung robotergestützter Demontage

Remanufacturing ist eine Schlüsselkomponente einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Es ermöglicht die Verringerung anfallenden Mülls und die Schonung natürlicher Ressourcen, was der Umwelt zugutekommt. Die Demontage ist die erste Stufe im Remanufacturing-Prozess und ist vor allem Handarbeit. Das Prinzip des Sammelverhaltens von Honigbienen soll helfen, diesen Prozess erfolgreich zu automatisieren.